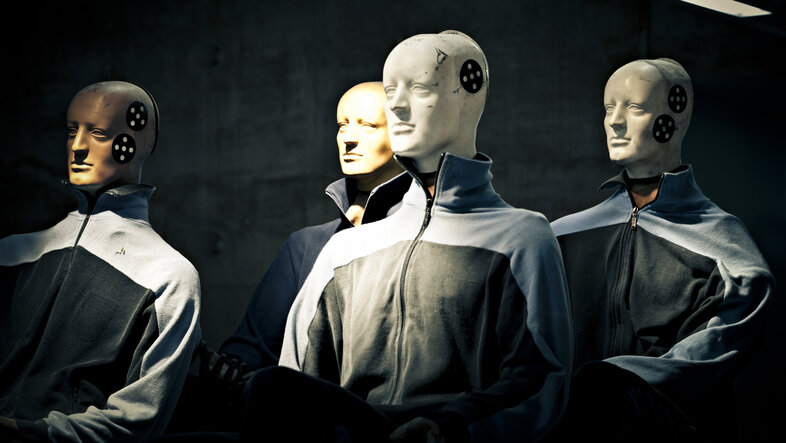An der Realität vorbei
Allein in Österreich sind nach aktuellsten Schätzungen 1,8 Millionen Menschen von chronischen Schmerzen betroffen – laut Statistik ist ein Großteil der Schmerzpatient*innen weiblich, erklärt Neurowissenschafterin Manuela Schmidt. Gemeinsam mit ihrem 11-köpfigen Team an der Universität Wien erforscht sie die molekularen Mechanismen hinter chronischen Schmerzen, um einen Beitrag zur Optimierung zukünftiger Behandlungsmethoden zu leisten.
Die meisten Schmerzmittel auf dem Markt sind schon ziemlich alt. Was "neu" ist, sind oft nur ihre Variationen, verrät uns Schmidt. Als die Vorläufer unserer gängigen Schmerzhelfer zugelassen wurden, waren Studien mit ausschließlich männlichen Probanden der Standard: "Bis vor gut zehn Jahren noch orientierte sich die Präklinik am kaukasischen Mann." Obwohl ein Großteil der Schmerzpatient*innen weiblich ist – wie passt das zusammen?
Ausrichtung an der männlichen Norm
Ausschlaggebend waren einerseits "forschungspraktische und ethische Gründe", berichtet Manuela Schmidt, die als Teamleiterin an der Universität Wien mehrere Studien gleichzeitig betreut: Sowohl in der Präklinik als auch in der klinischen Forschung ist es einfacher mit homogenen Gruppen zu experimentieren, da Ergebnisse leichter verglichen werden können. Da in der klinischen Forschung auch immer das Risiko besteht, dass sich Inhaltsstoffe auf die weibliche Reproduktionsfähigkeit auswirken, fiel die Wahl auf das männliche Geschlecht. Andererseits war es – wie in vielen anderen Bereichen auch – die Ausrichtung an der männlichen Norm, die dazu führte, dass "Medikamente sehr lange an der Realität vorbei entwickelt wurden", ergänzt Magdalena Eitenberger, die am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien u.a. zu Gendermedizin arbeitet.
Wenn wir Ungleichheit in Forschung und Medizin untersuchen, kommen wir schnell darauf, dass der weiße, gesunde, männliche Körper als Norm gilt und alles andere eine Abweichung darstellt.Magdalena Eitenberger
In den letzten Jahren hat sich – zumindest in der Schmerzforschung – einiges getan: "Damit die präklinische Forschung unsere diverse Gesellschaft abbilden kann, brauchen ernst zu nehmende Studien zumindest einen Geschlechtervergleich", so Manuela Schmidt. Mit ihrem Team konnte sie so beispielweise zeigen, dass das Protein Tmem160 die Schmerzentwicklung bei Nervenverletzung verzögert – allerdings nur in männlichen Individuen (zur Publikation). "Das ist ein Paradebeispiel dafür, warum es wichtig ist, die Geschlechter einzeln zu untersuchen. Hätten wir beide Geschlechter zusammen betrachtet, hätten wir einen mittleren, nicht signifikanten Effekt gesehen."
Von Diversität entfernt sind wir in der Forschung aber noch immer, lenkt Eitenberger ein. Mehrgewichtige Menschen – sowohl männliche als auch weibliche –, Personen in der Menopause, People of Color oder Transpersonen werden nach wie vor viel zu wenig in präklinischen Studien berücksichtigt. "Wir brauchen keine Technologien, die für eine 'Norm' gemacht sind, sondern Designs von Studien, Medikamenten und Strukturen im Gesundheitssystem, die auf eine breite und diverse Bevölkerung ausgerichtet sind", so Eitenberger.
Hürden und Rassismen im Gesundheitssystem
Einige Krankheiten treten bei bestimmten Bevölkerungsgruppen verstärkt auf, so zum Beispiel die Sichelzellanämie in Äquatorialafrika. Es handelt sich dabei um eine Erbkrankheit, bei der die roten Blutkörperchen eine Sichelform annehmen und bei welcher der Transport von Sauerstoff eingeschränkt ist – mit weitreichenden Konsequenzen. Betroffene leiden unter einer Beeinträchtigung der Organdurchblutung bis hin zu Organschäden, einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle oder Infekte und teilweise starken Schmerzen, erklärt Manuela Schmidt. Andererseits weisen die Träger*innen dieses genetischen Merkmals eine relative Resistenz gegen Malaria auf – ein Umstand, der in Malariagebieten durchaus vorteilhaft ist und daher verstärkt bei Personen äquatorialafrikanischer Abstammung vorkommt.
"Hier wissen wir noch viel zu wenig", beklagt Eitenberger, die in ihrer Arbeit einen intersektionalen Ansatz verfolgt. In der Forschung sind People of Color weniger vertreten und es müsste hier breitere Ansätze für diverse Bevölkerungsgrupen geben, stimmt Schmidt zu. Außerdem "zeigen Statistiken ganz deutlich, dass aus einem historischen Rassismus heraus People of Color bei der ärztlichen Untersuchung anderes behandelt werden, z.B. bei gleicher Symptomatik seltener Schmerzmittel verschrieben bekommen", ergänzt Eitenberger.
Gleiche Beschwerden, andere Zuschreibungen
Andere Krankheiten treten gehäufter beim biologisch-weiblichen Geschlecht auf. Die Schmerzerkrankung Fibromyalgie (bzw. das Fibromyalgie-Syndrom oder übersetzt "Faser-Muskel-Schmerz"), die mit ausgedehnten Schmerzen einhergeht und zu erheblichen Beschwerden führt, ist so eine Krankheit, unter der vor allem Frauen leiden, so Schmidt. Schwer therapierbare Migräne oder Rückenschmerzen, der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit, sind nicht speziell weiblich, werden aber von Frauen öfter und früher gemeldet. Hier vermuten Schmidt und Eitenberger psychosoziale Ursachen, die ein nach wie vor "traditionelles" Geschlechterbild reflektieren: "Weiblich gelesene Personen können Schmerzen eher zugeben, bei Männern scheint es eine größere Hemmschwelle zu geben."
Dieses "traditionelle" Geschlechterbild führe ebenso dazu, dass Beschwerden von weiblichen Personen eher auf psychische Ursachen zurückgeführt werden: "Dem Erfahrungshorizont weiblich gelesener Personen wird oft nicht ausreichend Beachtung geschenkt und physische Symptome werden schnell als 'eingebildet' abgestuft", erklärt Eitenberger. So kommt es zu teilweise sehr langen Diagnosewegen und Anzeichen, die übersehen werden.
Femtech – technische Lösungen?
Als grundsätzlich positiv stuft Eitenberger die Entwicklung ein, dass dem weiblichen Zyklus in der medizinischen Forschung mittlerweile mehr Beachtung geschenkt wird. "Viele Medikamente wirken zyklusbedingt anders, Stärke und Ausprägung chronischer Erkrankungen variieren je nach Zyklusphase." So wurde auch die Medizintechnik um eine neue Kategorie erweitert: Femtech. Dahinter stecken technologiebasierte Anwendungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen eingehen sollen – Periodentracker, smarte Tampons, Schwangerschaftsbegleiter am Handy oder Verhütungsapps. Doch es haben nicht alle weiblich gelesenen Frauen einen Zyklus, erinnert Eitenberger, und kritisiert das Frauenbild, das viele Femtech-Anwendungen untermauern: "Es geht wieder um eine Frau, die sich selber maßregelt, optimiert und für Themen wie Verhütung oder Reproduktion verantwortlich ist. Menstruation sollte – als eine Kategorie von vielen – in medizinischen Apps für alle integriert werden."
Stichwort für alle: Eine Gefahr, die Eitenberger bei der gesamten Debatte um Gendermedizin beobachtet und auf die sie immer wieder hinweist, ist die Fokussierung auf zwei Geschlechter. "Wo wir Unterschiede suchen, werden wir Unterschiede finden, und es ist sehr wichtig, in der Gendermedizin auf Unterschiede einzugehen" – doch Gender ist auch sehr fluid und von vielen Faktoren abhängig. "So divers wie unsere Gesellschaft ist, so divers müssen schlussendlich auch unsere medizinischen Ansätze sein." (hm)
Sie forschte und lehrte in Würzburg, Kalifornien und Göttingen, bevor sie 2020 an die Universität Wien kam. Sie ist Vizedekanin der Fakultät für Lebenswissenschaften.
Bevor sie an das Institut für Politikwissenschaft kam (2023), arbeitete Magdalena Eitenberger am Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety und am Institut für Ethik und Recht in der Medizin sowie als Projektmanagerin im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz während der COVID-19 Pandemie.