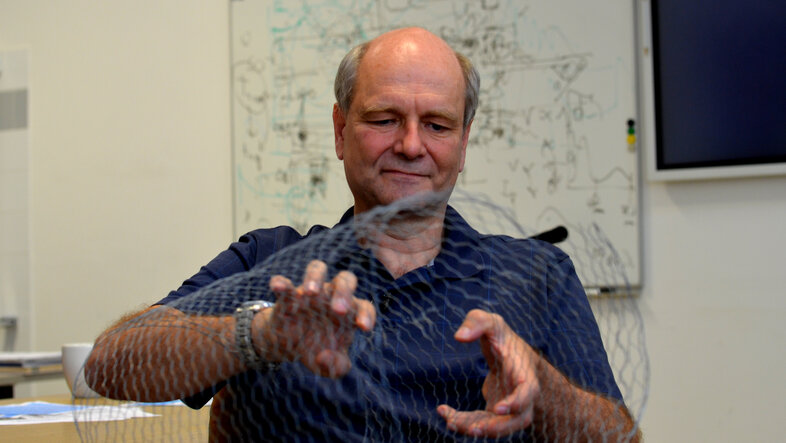Die Vermessung der Nanomaterie
Nanomaterialien kommen in der Natur vor, etwa im Rauch aus einem Feuer, entstehen bei Verbrennungsreaktionen oder werden gezielt technologisch hergestellt, um bestimmte Funktionen zu erfüllen. Neben ihrer ungewöhnlichen Größe – Nanomaterialien sind bis zu 10.000 Mal kleiner als ein menschliches Haar – sind sie deshalb so besonders, weil sie andere chemische und physikalische Eigenschaften haben können als ihre Pendants in größeren Partikeln.
Sie sind das Herzstück vieler technologischer Innovationen und gelten als Hoffnungsträger für Energielösungen im Rahmen des European New Deal, einem Konzept, das die Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 zum Ziel hat. Um die winzigen Partikel verstehen und mit ihnen arbeiten zu können, müssen Forscher*innen aber erstmal in der Lage sein, ihre atomare Struktur zu sehen und gleichzeitig ihre lokalen Eigenschaften zu bestimmen. Bisher war das mit einem einzelnen Verfahren nicht möglich, sondern nur durch die Kombination verschiedener Messinstrumente in Großforschungseinrichtungen. Doch Thomas Pichler, Professor für Quanten- und Festkörper an der Uni Wien, will diesen "Traum für Physiker*innen", wie er es nennt, nun im Rahmen des groß angelegten Forschungsprojekts MORE-TEM wahr werden lassen.
Video mit Thomas Pichler: Nanomaterialien verstehen lernen
"Tischversion" einer Großforschungseinrichtung
Gemeinsam mit einem internationalen Team an Forschenden soll ein weltweit einzigartiges, bahnbrechendes Elektronen-Nanospektrometer in Wien entwickelt werden. "Im Prinzip geht es also darum, die verschiedenen Messstationen in einem Gerät zu vereinen," erklärt Pichler die Vision einer deutlich kleineren und billigeren "Tischversion" einer Großforschungseinrichtung. So ein Gerät würde einen Durchbruch für die Analyse von Proben darstellen, da es die Vorteile der Elektronenmikroskopie mit hochauflösender Spektroskopie in einem Nanospektrometer verbindet, "außerdem wäre es ein Riesenvorteil in der Anwendung, da sich damit die Eigenschaften vieler moderne Nanomaterialien überhaupt erstmals lokal analysieren lassen werden." Zur Umsetzung von MORE-TEM hat das Forschungsteam einen mit 14 Millionen Euro dotierten Synergy Grant des Europäischen Forschungsrats über sechs Jahre erhalten.
Die Anwendungsmöglichkeiten einer solchen Super-Maschine sind äußerst vielfältig. Sie reichen von Grundlagenstudien zur Entstehung von Quantenphasenübergängen, wie zum Beispiel Supraleitung – darunter versteht man die quasi widerstandsfreie Leitung von Strom in einigen Materialien bei tiefen Temperaturen – bis zum Konstruieren von Nanomaterie mit atomistischer Kontrolle. Es sind aber auch direkte Optimierungen technologischer Anwendungen möglich, zum Beispiel von Lithium-Ionen-Batterien.
Nachhaltige Energiespeicher: Lithium-Ionen-Batterie
Lithium spielt derzeit eine große Rolle für die Herstellung effizienter Stromspeicher. Lithium-Ionen-Akkus kommen in vielen mobilen Geräten, als Batterien für Elektroautos oder als Stromspeicher in der Photovoltaik zur Anwendung. „Wenn etwas in einer solchen Batterie kaputt geht, dann möchte ich sehen, wo es kaputt geht und was dort lokal passiert," erklärt der Physiker und Koordinator des Projekts, der selbst Experte für Elektronenspektroskopie und optische Spektroskopie ist: "Denn verschiedene Aspekte wie der Ladungstransfer an der „Graphitelektrode“, die Leitfähigkeit, Ladegeschwindigkeit oder die Stabilität der Struktur beeinflussen die Leistung einer Lithium-Ionen-Batterie."
Ziel sei es, ein System zu entwickeln, dass all diese Aspekte gleichzeitig mikroskopisch und spektroskopisch erfasst. Bisher könne man das nur mit verschiedenen, hintereinander kombinierten Messmethoden. "Und das ist ein großes Problem," resümiert er: "Denn man weiß nie, ob zwischen den Messungen noch etwas anderes in der Batterie passiert ist." Neben der vereinfachten Anwendung ist es also vor allem die lokale Analyse und Gleichzeitigkeit der Messungen, die interessante neue Blickwinkel eröffnet.
Mehr Infos zum Projekt
Das ERC-Projekt MORE-TEM vereint unterschiedlichste Fachkenntnisse. Neben dem Koordinator Thomas Pichler von der Universität Wien sind der japanische Wissenschafter Kazu Suenaga von der Osaka University in Suita (Fachmann für Elektronenmikroskopie), Francesco Mauri von der Universität La Sapienza in Rom (Theoretiker für ab-initio-Spektroskopie) und Max Haider von der CEOS GmbH (Experte für Elektronenoptik) am Projekt beteiligt.
Wissenschaftliche Grenzen ausloten
"Wir haben für den Synergy Grant ein komplementäres Team weltweit führender Experten gefunden", erzählt Pichler, "die sich ergänzende Expertise ist entscheidend." Im heutigen Wissenschaftsbetrieb habe man nur selten die Möglichkeit, langfristig an einem größeren Projekt zu arbeiten. Der Physiker freut sich besonders über die Möglichkeit, stark in die Grundlagenforschung zu gehen und auch die wissenschaftlichen Partner seien daran am meisten interessiert: "Unser Ziel ist es, die Grenzen auszuloten: Wie weit kann man wissenschaftlich gehen?". Nur wenn man die Grenzen kenne, wisse man in welche Richtung man ein Produkt entwickeln könne, das auch industriell von Bedeutung ist. "In der Grundlagenforschung steht man vor ganz anderen Problemen, Herausforderungen und findet auch andere Lösungen, wie wenn man nur optimiert," ist Pichler überzeugt. Die revolutionärsten Entwicklungen seien schließlich oft zufällig entstanden.